Ein BMW Cabrio biegt auf die Straße vor dem Haus ein. Das schicke Auto rollt auf den Parkplatz, ein ältlicher Mann mit Wohlstandsbauch, leger in Hemd und Jeans gekleidet, steigt aus und klingelt an Manfreds Haustür. Es ist Manfreds Chef.
Bevor wir mehr erfahren, ist eine kleine Einleitung nötig. Die Geschichte, die ich gerade begonnen habe zu erzählen, trug sich in meinem Umfeld zu, aber die Person möchte aus nachvollziehbaren Gründen nicht genannt werden. Wir nennen sie daher einfach Manfred. Ich habe das ganze Drama mitbekommen und finde es einfach zu grotesk, um nicht drüber zu schreiben..
Manfreds Arbeitgeber ist ein kleines mittelständisches B2B-Software-Unternehmen mit zwei Handvoll Mitarbeitern. Bevor alle Mitarbeiter Corona-bedingt ins Home Office geschickt wurden, musste jeder noch unterschreiben, dass er grundsätzlich mit Kurzarbeit einverstanden wäre. Eine reine Formalität und nur für den Fall der Fälle, hieß es von der Geschäftsleitung.
Mitarbeiterkommunikation of Doom
Zunächst ging es auch ganz normal weiter. Morgens konnte Manfred länger schlafen, da die Pendelei wegfällt. Mails schreiben und telefonieren geht ja auch problemlos von zu Hause aus. Warum genau soll man nochmal jeden Tag zig Kilometer hin und her pendeln? Eigentlich gar nicht so schlecht, dieses Home Office. Von Kurzarbeit war auch erstmal keine Rede mehr.
Aber alles Gute hat einmal ein Ende. Per Mail schickte die Geschäftsführung ein oder zwei Wochen später an alle Mitarbeiter einen Dienstplan raus. Das war neu für Manfred, bisher hatte er einfach von 8 bis 5 gearbeitet. So erfahren die Kollegen nun aus dem Dienstplan, dass sie ab April offenbar in Kurzarbeit gehen. Manfred liest mit steigender Verwunderung, dass er im April nur noch zweimal die Woche morgens zum Schreibtisch schlurfen muss, die restlichen Tage sind frei, Kurzarbeit. Im Mai wird er noch seltener eingesetzt.
Aber Manfred hat noch Glück, Kollegen aus einer anderen Abteilung haben ab April einfach nur noch eine dicke 0 in der Monatsübersicht stehen.
Eine Information vonseiten der Geschäftsführung gab es dazu nicht. Dabei hatten Manfred und seine Kollegen viele Fragen, was das alles denn nun genau bedeuten mag. Erst auf Nachfrage erfuhr Manfred, wie diese Kurzarbeit nun genau funktioniert.
Kurzarbeit funktioniert eigentlich ganz einfach: Die Angestellten arbeiten weniger und ihr Arbeitgeber hat dadurch weniger Personalkosten. Für die Zeit, die ein Mitarbeiter weiterhin regulär arbeitet, wird er ganz regulär vom Arbeitgeber bezahlt. Muss/darf/kann er im Rahmen von Kurzarbeit nicht arbeiten, muss er trotzdem nicht verhungern: Die Agentur für Arbeit zahlt ihm dafür 60 % seines normalen Nettogehalts als Kurzarbeitergeld. Er bekommt also mindestens 60 % seines normalen Monatsgehaltes, plus eventuell mehr, falls er in diesem Monat noch ein wenig arbeiten konnte.
Man hätte vieles richtig machen können
Yay, mehr Freizeit!, mag man denken. Dachte Manfred auch, einerseits. Aber mäh, nur noch 60-80 % Gehalt? Da sind keine großen Sprünge mehr drin, falls das länger andauert. Oder Auto-Reparaturen, oder eine neue Waschmaschine oder sonstiges Zeug, das mal kaputt gehen kann. Wie lange die Kurzarbeit andauert, konnte ihm sein Chef, Geschäftsführer des Unternehmens, auch nicht sagen. Klar, wir wissen ja auch bis heute noch nicht, wann alles wieder „normal“ wird.
Es hätte nun verschiedene Wege gegeben, diese Kurzarbeit-Entscheidung an die Mitarbeiter zu kommunizieren. Schließlich ist Manfreds Firma kein Börsenkonzern mit Tausenden von Mitarbeitern auf unterschiedlichen Kontinenten. Nein, man kennt sich. Normalerweise sitzt man zur Mittagspause zusammen am Tisch.
Die Firma ist recht klein und jeder Mitarbeiter ist gut eingearbeitet und daher wertvoll. Krisensituationen sind eine hervorragende Gelegenheit, um das eigene Ansehen zu verbessern. Man hat die Möglichkeit, viel richtig zu machen und dadurch an Ansehen zu gewinnen und Loyalität zu fördern (siehe Kanzlerin Merkel während der Pandemie). Unternehmenstechnisch gesehen wären zufriedene und dankbare Mitarbeiter eine Investition in die Zukunft. Man kann aber auch viel falsch machen und dadurch Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielen (siehe Trump).
Die Geschäftsleitung von Manfreds Unternehmen hätte also eine Skype-Konferenz einberufen können. In dieser Konferenz hätte man den Mitarbeitern so persönlich wie aktuell möglich erläutern können, was geplant ist. Und für wie lange. Und was das genau für den Einzelnen bedeutet. Vielleicht hätte man auch ankündigen können, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, so dass die Mitarbeiter keine Einbußen haben.
Man hätte die Moral heben können, ein paar Worte zum Zusammenhalt sagen können, ein „Wir stehen das gemeinsam durch“ oder „Wir werden diese Zeit der Kurzarbeit so kurz wie möglich halten“, und „Keiner wird zurückgelassen“. Oder man hätte das Ganze wenigstens als Mail formulieren können – alles besser als nichts.
Nun hat man einfach eine Liste rausgeschickt und seine Mitarbeiter kommentarlos alleine entdecken lassen, dass sie die nächsten Monate deutlich weniger Geld bekommen.
Von Sportwagen und Gehaltseinbußen
Das kam nicht so gut an in der Belegschaft. Zumal die Chefetage laut Plan wie üblich fünf Tage die Woche arbeiten und daher keinerlei finanzielle Einbußen haben wird. Es wurde gemurrt. „Toll, die scheren sich nicht um uns und sich zahlen sie natürlich weiter aus“. Bis zum Chef sprach es sich durch, dass das Raussenden des Plans vielleicht als unsensibler Schlag ins Gesicht aufgefasst worden sein könnte.
Der Chef reagiert und sucht nun das Einzelgespräch. Nicht via Skype oder per Telefon. Nein, er wollte es diesmal richtig machen, ganz persönlich. „Ich komme zu Ihnen, wann passt es Ihnen?“, fragt er Manfred aus heiterem Himmel fernmündlich. Manfred erschreckt sich. Er wusste nicht, was sein Chef will. Gibt es Ärger? Und vielleicht will er seinen Chef gar nicht unbedingt bei sich zu Hause haben – aber das sagt man dem Vorgesetzten natürlich nicht.
Und so sind wir nun am Anfang. Chef im Cabrio rollt auf die Einfahrt. Manfred setzt sich mit ihm auf die Terrasse, damit man in Ruhe reden kann. Aber zunächst muss das Eis brechen, Small Talk ist angebracht. Der Chef nimmt seine Sonnenbrille ab. „Ach, Corona“, seufzt er. „Diese Brille habe ich maßanfertigen lassen. Da weiß man wenigstens, was man hat. Aber ich habe sie leider neulich etwas verbogen. Und nun haben alle Optiker zu und ich muss sie so tragen.“

Auch Manfred wartet. Er würde gern wissen, was denn nun kommt. Wie der Chef die Kommunikationspanne wieder gut machen will. Aber natürlich stimmt er seinem Chef zu. Ärgerlich, wenn die teure Brille leider nicht perfekt sitzt.
Er selbst allerdings muss seine finanziellen Prioritäten auch bei vollem Gehalt anders setzen als auf maßangefertigte Sonnenbrillen. Der Chef teilt ihm nun mit, dass Manfred ab Juni das restliche Jahr zu Hause bleiben wird. Wegen der finanziellen Situation. Da muss man zusammenhalten, um die Firma und die Arbeitsplätze zu retten. Jeder muss seinen Teil dazu leisten.
Ungläubig hört Manfred zu. Da kreuzt dieser Mann, der ganz normal weiterarbeiten wird, mit seiner maßangefertigten Brille im schicken BMW Cabrio auf und informiert ihn darüber, dass er jetzt ein halbes Jahr mit 60 % seines üblichen Gehaltes klarkommen muss, da jeder seinen Teil beitragen muss. Irgendwie ist das komisch und grotesk zugleich.
Wie man ganz einfach Engagement zerstört
Es kommt heraus, dass Manfred Team aufgeteilt wird. Die eine Hälfte der Kollegen bleibt zu Hause, wie Manfred. Die andere Hälfte teilt sich die Arbeit auf und wechselt sich ab. Manfred braucht etwas Zeit, um das zu verdauen, er fühlt sich auf die Ersatzbank verbannt.
„Vielen Dank für Ihr Verständnis“, sagt der Chef am Ende und schwingt sich wieder ins Cabrio. Klar, ähm, gerne.
Auch hier hätte man einiges machen können. Es geht darum, Geld einzusparen und die Firma durch schwere Zeiten zu bringen. Das zu kommunizieren, während man dem Angestellten seinen Sportwagen und die sündhaft teure Sonnenbrille unter die Nase reibt, ist vielleicht nicht so sensibel. Wasser predigen und Wein trinken.
Da Menschen mit mehr Geld einen größeren finanziellen Spielraum haben als Menschen mit weniger Geld, wäre es ein glaubwürdiges Zeichen gewesen, wenn der Chef und seine Schergen auf einen kleinen Teil ihres Gehaltes verzichten würden. Wenn ihr eigener Arbeitseinsatz schon so unverzichtbar ist, dass sie zu 100 % weiterarbeiten.
Es sendet auch interessante Signale, wenn die eine Hälfte des Teams sehen kann, wo sie bleibt, während die andere Hälfte sich die Arbeit aufteilt. Für den kollegialen Zusammenhalt wäre es hier sicher besser gewesen, wenn jeder, auch nur pro forma, ein oder zweimal die Woche hätte arbeiten dürfen.
Zwei sind nun froh, dass sie nicht auf 60 % degradiert wurden und werden sich daher eher nicht solidarisch für die beiden anderen einsetzen, weil ihnen dieser Einsatz noch weitere Einbußen bescheren könnte. Und die beiden anderen werden vermutlich jegliche Lust verloren haben, sich jemals wieder motiviert für die Firma einzusetzen.
Alle sind gleich, aber manche sind gleicher
Da stecken mit Sicherheit unternehmerische Überlegungen hinter, die Manfred (und ich schon gar nicht) nicht nachvollziehen kann.
Was aber bleibt, ist der bittere Nachgeschmack, dass „jeder muss seinen Teil beitragen“ nicht ganz gerecht aufgeteilt ist. „Jeder“ sollte eigentlich wirklich jeden meinen, und es reicht nicht, dass die Sonnenbrille warten muss. Ich kann mir nur vorstellen, dass die unsensible Herangehensweise und vor allem die ungleiche Aufteilung der restlichen Arbeitszeit für viel Unruhe sorgen wird.
Alle sind gleich, aber manche sind gleicher – das sagte George Orwell in seinem Roman Animal Farm. In Manfreds Firma muss jeder seinen Teil zur Rettung der Firma beitragen, aber manche wohl mehr, und andere weniger.
Diejenigen, die hängen gelassen wurden, werden das so schnell nicht vergessen. Vermutlich hätte die Firma diese Leute auch gleich feuern können, denn weiterhin auf ihre Loyalität und ihr Engagement zu zählen, könnte sich nun als trügerisch erweisen. Letzten Endes kommt sowas eine kleine Firma vermutlich teurer zu stehen als kurzfristige Einsparungen bei den Personalkosten.
Aber naja, der Chef hatte nicht mal die Feinfühligkeit, um zu merken, dass er mit seinem Cabrio-Sonnenbrillen-Auftritt Marie Antoinette und dem ihr untergeschobenen Spruch „Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen“ Konkurrenz macht.





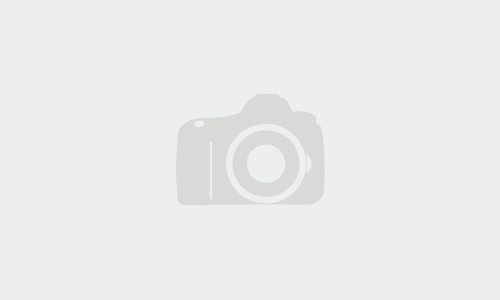
Wenn der mir so gekommen wäre, hätte ich ihm die Meinung gegeigt und ihm die Kündigung gleich mitgegeben. Was bildet der sich eigentlich ein?